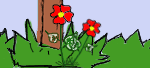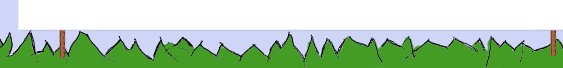| | 
Borderline:
Kennzeichnend für die Borderline-Störung ist eine fortgesetzte Instabilität in sozialen Beziehungen, im Selbstbild und der Stimmung.
Dies zeigt sich zum Beispiel in der Neigung zu selbstgefährdendem Verhalten oder starken Gefühlsausbrüchen.
Die Borderline-Störung zeichnet sich durch ein fortlaufendes Muster von Instabilität in sozialen Beziehungen, im Selbstbild und der Stimmung aus. Der Borderline-Begriff entstand aus der Annahme, dass sich diese Störung im Grenzbereich (Borderline) zwischen Neurose und Psychose bewegt, da die Betroffenen neben einer gestörten Charakterstruktur auch vereinzelt psychotische Symptome, wie beispielsweise Verfolgungsideen, zeigen.
Im Zentrum der Borderline-Störung stehen Schwierigkeiten bei der Regulation von Gefühlen. Diese können sich auf verschiedenen Ebenen zeigen:
Die Borderline-Betroffenen sind oft verzweifelt bemüht, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. Dabei werden beispielsweise schon zeitlich begrenzte Trennungen oder auch minimale Verspätungen des anderen als sehr bedrohlich empfunden und lösen starke Ängste aus. Häufig schätzen sich Personen, die unter einer Borderline-Störung leiden, selbst als "böse" ein, weil sie "doch schließlich" verlassen worden sind.
Die Wahrnehmung und Einschätzung der eigenen Person ist bei einer Borderline-Störung sehr wechselhaft. Diese Instabilität bezüglich der eigenen Identität zeigt sich zum Beispiel in einem häufigen Wechsel von Berufswünschen oder Wertvorstellungen. Im Selbstbild sehen sie sich oft als "böse" oder "sündig" oder haben zeitweise, insbesondere bei angenommenem "Verlassensein" das Gefühl, gar nicht zu existieren.
Ein weiteres Kennzeichen der Borderline-Störung ist die Neigung zu selbstgefährdendem Verhalten. Dies zeigt sich zum einen in einer starken Impulsivität in Bereichen, die potentiell selbstschädigend sind, so zum Beispiel riskantes Autofahren, Glücksspiel, Fressanfälle oder Drogenmissbrauch. Aber auch direkte Selbstschädigungen wie Selbstverletzungen, zum Beispiel indem man sich selbst Schnitte oder Brandwunden zufügt oder Selbstmordandrohungen und Selbstmordversuche treten im Rahmen der Borderline-Störung häufig auf. Diese selbstschädigenden Handlungen stehen oft im Zusammenhang mit dem Versuch, ein "Verlassenwerden" zu vermeiden, können aber auch als eine Art von "Strafe" für die eigene "Sündigkeit" dienen oder den Betroffenen helfen, sich selbst wieder zu spüren.
Die Gefühlslage von Menschen mit einer Borderline-Störung ist sehr wechselhaft, so kommt es bei eher gedrückter Grundstimmung zu Perioden von starker Erregbarkeit, Angst oder Verzweiflung. Diese sind häufig Ausdruck der Neigung, sehr schnell und extrem auf zwischenmenschliche Belastungen zu reagieren. Insbesondere wenn der Betroffene Vernachlässigung oder Zurückweisung erlebt, kommt es oftmals zu Wutausbrüchen, die für die Betroffenen kaum zu kontrollieren sind.
Menschen mit einer Borderline-Störung klagen vielfach über ein anhaltendes Gefühl innerer Leere; sie leiden unter einem quälenden Gefühl der Langeweile und sind häufig auf der Suche nach einer Beschäftigung.
Unter extremen Belastungen, wie beispielsweise unter Drogeneinfluss oder bei einem tatsächlichen oder erwarteten Verlassenwerden, können vorübergehend Verfolgungsideen oder so genannte dissoziative Symptome auftreten. Diese Symptome können sich beispielsweise in einer veränderten Wahrnehmung der eigenen Person oder des eigenen Körpers, oder in einer Schmerzunempfindlichkeit äußern.
Symptome des Borderline-Syndroms :
Körperliche Ebene
innerliche Hochspannung
Schlafstörungen
Alpträume
Konzentrationsstörungen
Taubheitsgefühle
innere Leere
Unwirklichkeitsgefühle
das Gefühl, vom Körper getrennt zu sein
Wahrnehmungen, Vorstellungen und Bilder, die ängstigen
Emotionale Ebene
Gefühlswirrwarr oder Gefühlsüberflutung
Niedergeschlagenheit
Hoffnungslosigkeit
Angstzustände
Schuld- Scham- Ekelgefühle
Wut und Ärger
rasche Stimmungsveränderung zwischen Angst, Ärger und Depression
Schwierigkeiten, die Gefühle wahrzunehmen
Gedankliche Ebene
Selbstabwertung und Selbstvernichtung
Versagensgedanken
Schuldvorwürfe
Gedanken der Hilfs- und Hoffnungslosigkeit
Schwarzweiß-Denken
Entweder-oder- und Alles-oder-nichts-Denken
Verhaltensebene
sozialer Rückzug -Aufgabe von Kontakten, Aufgabe von beruflichen und Freizeitinteressen
Anklammerung und Vermeidung von Alleinsein
Beziehungskonflikte
Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen
Impulsive Handlungen
Selbstbeschädigung und Selbstverletzung
Selbsttötungsversuche
Selbstverletzendes Verhalten:
Mit selbstverletzendem Verhalten (SVV) oder autoaggressivem Verhalten beschreibt man eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, bei denen sich betroffene Menschen absichtlich Verletzungen oder Wunden zufügen.
Es gibt verschiedene Arten der Selbstverletzung; häufig werden mehrere von einer Person angewandt. Zu den häufigsten zählen
das Aufschneiden, Aufkratzen oder Aufritzen (sog. Ritzen) der Haut an den Armen und Beinen mit spitzen und scharfen Gegenständen wie Rasierklingen, Messern, Scheren oder Scherben; eine Häufung der Narben ist am nicht-dominanten (Unter-)Arm zu finden, aber auch beide Arme können von Narben übersät sein, wie auch zum Beispiel Bauch, Beine, Brust, Genitalien oder das Gesicht.
wiederholtes "Kopfschlagen" (entweder mit den eigenen Händen gegen den Kopf, ins Gesicht oder mit dem Kopf an Gegenstände)
das Schlagen des Körpers (zum Beispiel Arme und Beine) mit Gegenständen
das Ausreißen von Haaren (Trichotillomanie)
In-die-Augen-Bohren
Mit Nadeln (Sicherheitsnadeln etc.) stechen
Das Beißen in erreichbare Körperpartien, auch Abbeißen von Fingerkuppen und "Zerkauen" der Innenseite von Wangen oder Lippen
Verbrennungen und Verbrühungen (zum Beispiel Zigarettenausdrücken auf dem eigenen Körper, Hand über eine Kerze halten)
Orale Einnahme schädlicher Substanzen (wie zum Beispiel Reinigungsmittel)
Intravenöse, subkutane oder intramuskuläre Injektion schädlicher Substanzen
Verätzung des Körpers durch Chemikalien
Wangenkauen (siehe auch Morsicatio buccarum)
Fingernägelkauen (Onychophagie), wobei die leichteren, auf Nervosität beruhenden Formen nicht unbedingt zu den Selbstverletzungen gezählt werden, jedoch schmerzende Nagelverletzungen und Ausreißen der Nägel Selbstverletzungen darstellen.
Es ist umstritten, ob bei der Verletzung des eigenen Körpers Endorphine (Glückshormone) ausgeschüttet werden, die den Schmerz lindern, wie es bei körperlicher Anstrengung oder auch einer Geburt der Fall ist. Diese werden in Verbindung mit Adrenalin ausgeschüttet, da der Körper durch die Selbstverletzungen in eine starke Form des Stresses versetzt wird.
Es steht fest, dass eine Gewöhnung stattfindet, die extremere Selbstverletzungen nach sich zieht (tiefere Schnitte, großflächigere Verbrennungen), um die gesuchte Befriedigung zu erreichen.
Nicht immer allerdings werden Endorphine oder Adrenalin ausgeschüttet; bei "Beißern" tritt nicht die Form des Stresses auf, sondern genau das Gegenteil: Der Betroffene steht unter Druck. Besonders durch das Beißen im Mundinneren wird Stress, enormer Druck, abgebaut. Wie bei anderen Verletzungen auch werden die Wunden immer größer bzw. tiefer, um den (wiederum durch das Beißen provozierten und gesteigerten) Druck abbauen zu können. Überdies ist therapeutisch nicht eindeutig erwiesen, ob es sich bei autoaggressivem Verhalten um eine Art "Selbstbelohnungs- oder Selbstbestrafungstrieb" handelt.
Gründe:
Flucht vor der Leere, Depression, und Gefühle der Derealisation.
um damit Spannung abzubauen.
Erleichterung: wenn sich intensive Gefühle aufbauen, sind SVV-ler überwältigt und unfähig, sie zu verarbeiten. Indem sie sich Schmerzen zufügen, reduzieren sie den Level der emotionalen und körperlichen Spannung auf ein erträgliches Niveau.
Als Ausdruck emotionalen Schmerzes
Flucht vor Betäubtsinsgefühlen: viele derer, die sich selbst verletzen sagen, daß sie es tun, um nur irgendetwas zu fühlen, zu fühlen, daß sie noch leben.
Um ein Gefühl der Euphorie zu erlangen
Weiterführen von Mißbrauchserfahrungen: SVV-ler sind häufig als Kinder mißbraucht worden. Manchmal ist die Selbstverletzung ein Weg, sich selbst dafür zu bestrafen, daß man "böse" war/ist.
Erleichterung von Wut: viele SVV-ler haben eine enorme Menge an Wut in sich. Aus Angst, sie nach außen zu richten, verletzen sie sich selber um diesen Gefühlen freien Lauf lassen zu können.
Biochemische Erleichterung: es gibt Vermutumgen, daß Erwachsene, die als Kinder wiederholt traumatisiert wurden, es sehr schwer haben zu einem normalen Erregungslevel zurückzukehren und sind in einem gewissen Sinne süchtig nach diesem "Krisenverhalten".
Das Erreichen oder Aufrechterhalten des Einflusses auf das Verhalten Anderer
Das Erreichen des Gefühls der Kontrolle über den eigenen Körper
Fundament der Realität, ein Weg, um mit Gefühlen der Depersonalisation und Dissoziation umzugehen
Erhaltung des Gefühls der Sicherheit oder Einzigartigkeit
Ausdruck oder Unterdrückung von Sexualität
Ausdruck oder Umgang mit einem Gefühl der Inbesitznahme
Dissoziative Identitätsstörung
Die Dissoziative Identitätsstörung oder Multiple Persönlichkeitsstörung ist eine dissoziative Störung, bei der Wahrnehmung, Erinnerung, und das Erleben der Identität betroffen ist. Sie gilt als die schwerste Form der Dissoziation. Die Patienten bilden zahlreiche unterschiedliche Persönlichkeiten, die abwechselnd die Kontrolle über ihr Verhalten übernehmen. An das Handeln der jeweils "anderen" Personen kann sich der Betroffene entweder nicht - oder nur schemenhaft - erinnern oder er erlebt es als das Handeln einer fremden Person.
Patienten mit einer dissoziativen Identitätsstörung weisen zwei oder mehr unterschiedliche Persönlichkeiten auf, die abwechselnd, aber nie gemeinsam sichtbar sind und getrennte Gedanken, Erinnerungen, Verhaltensweisen und Gefühle äußern. Der Wechsel von einer Person zur anderen wird nicht wahrgenommen. Das Handeln einzelner Persönlichkeiten kann ebenfalls vollständiger Amnesie unterliegen.
Panikstörung/Agoraphobie:
Die Panikstörung gehört zur Gruppe der Angststörungen. Die Betroffenen leiden unter plötzlichen Angstanfällen, ohne dass objektiv gesehen eine reale Gefahr besteht. Diese Panikattacken stellen eine extreme körperliche Angstreaktion ("Bereitstellungreaktion") aus scheinbar heiterem Himmel dar, die die Betroffenen als extreme Bedrohung ihrer Gesundheit erleben. Der Körper bereitet sich mit erhöhter Adrenalin-Ausschüttung blitzschnell auf eine Kampf-/Fluchtreaktion vor.
Körperliche Reaktionen bei der Panikstörung sind unter anderem Atemnot, Engegefühle in der Brust, Herzrasen oder -stolpern, gelegentlich auch Herzschmerzen, Zittern, Schweißausbrüche, Taubheitsgefühle oder Kribbeln, Übelkeit und andere Beschwerden (Hyperventilieren). In der Regel bessern sich die Symptome analog zum Adrenalin-Abbau nach etwa 15 bis 20 Minuten. Psychische Symptome der Panikstörung sind Schwindelgefühle, Angst vor Kontrollverlust, verrückt zu werden oder "auszuflippen" und die Angst zu sterben. Allgemeine Symptome sind Hitzegefühle oder Kälteschauer.
Die Angst davor, plötzlich eine Panikattacke zu erleben in einer Situation, der man nicht schnell entfliehen kann oder wo keine Hilfe verfügbar ist, führt häufig dazu, dass Betroffene beginnen, enge Räume, Menschenansammlungen oder weite Reisen zu vermeiden. In schweren Fällen können sie die eigene Wohnung nicht mehr allein verlassen. Dieses Vermeidungsverhalten bezeichnet man als Agoraphobie.
Phobien:
Eine Phobie auch phobische Störung, ist eine krankhafte, das heißt unbegründete und anhaltende Angst vor Situationen, Gegenständen, Tätigkeiten oder Personen, allgemein vor dem phobischen Stimulus. Sie äußert sich im übermäßigen, unangemessenen Wunsch, den Anlass der Angst zu vermeiden.
Ohne damit eine eindeutige Unterscheidung zwischen "normalen Ängsten" und phobischen Störung zu ermöglichen, sprechen folgende Kriterien für eine phobische Störung:
1. die Angst ist der Situation erkennbar nicht angemessen
2. die entsprechenden Angstreaktionen halten deutlich länger an, als nötig wäre
3. die besonders geartete Angst ist durch die Betroffenen weder erklärbar, beeinflussbar noch zu bewältigen
4. die Ängste führen zu deutlichen Beeinträchtigungen des Lebens der Betroffenen
5. die Ängste schränken den Kontakt zu fremden Menschen ein
Agoraphobie
Wörtlich bedeutet der Begriff Agoraphobie "Angst vor dem Marktplatz" (Platzangst; oft fälschlich für Raumangst (Klaustrophobie)) und stammt aus dem Griechischen. Zusammenfassend ist damit eine Angst vor öffentlichen Räumen, Menschenansammlungen oder allgemeiner formuliert Situationen, von denen aus eine Flucht oder das Bekommen von Hilfe (in Not) schwierig wäre. Diese Angst tritt besonders heftig auf, wenn sich der oder die Betroffene allein an diesen Orten aufhält. Erkrankte Personen vermeiden daher öffentliche Verkehrsmittel, lange Autofahrten auf Autobahnen oder abgelegenen Landstraßen, aber auch das Einkaufen oder einen Bummel durch die Innenstadt. Zum Teil sind Betroffene nur in Begleitung einer vertrauten Person in der Lage, die alltäglichen Anforderungen zu meistern. In besonders schweren Fällen kommt es aber zur vollkommenen Isolation, wenn also das Haus oder die Wohnung als schützende Räume nicht mehr verlassen werden oder verlassen werden können.
Soziale Phobien
Kennzeichnend für die Soziale Phobie ist die Furcht, von anderen beobachtet und negativ bewertet zu werden, z. B. bei einem Vortrag ("Bestimmt fange ich an zu stottern und blamiere mich bis auf die Knochen") oder beim Essen ("Meine Hände werden zittern, die anderen glauben sicher, ich bin Alkoholiker"). Die Ängste können sehr ausgedehnt (fast alle Kontakte werden gemieden) oder eng umschrieben sein ("Nur, wenn ich Schecks unterschreiben muss").
| |